Knappe Rohstoffe –
große Aufgaben
Ob beim Hausbau, im Möbelstück oder aus dem Wasserhahn: Wir nutzen täglich Ressourcen, die nicht unbegrenzt verfügbar sind. Kies, Holz und Wasser gehören zu den zentralen Rohstoffen unserer Wirtschaft – und sie stehen unter Druck. Der Klimawandel bringt Dürreperioden und Starkregen, Genehmigungsverfahren bremsen den Rohstoffabbau, Wälder müssen sich neu erfinden. Auch in Schleswig-Holstein zeigen sich die Herausforderungen: 2021 wurden laut dem Verband der Bau- und Rohstoffindustrie hierzulande 23,4 Millionen Tonnen Sand und Kies im Wert von mehr als 150 Millionen Euro gefördert. Doch genehmigte Flächen werden knapp. Holz ist ein Baustoff mit Tradition, aber verlässliche Lieferketten und klimaresistente Wälder werden zur Zukunftsfrage. Und Wasser? Ist da, aber oft am falschen Ort zur falschen Zeit. Unternehmen im Land stellen sich diesen Herausforderungen und entwickeln Ideen für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem, was irgenwann einmal verbraucht ist.
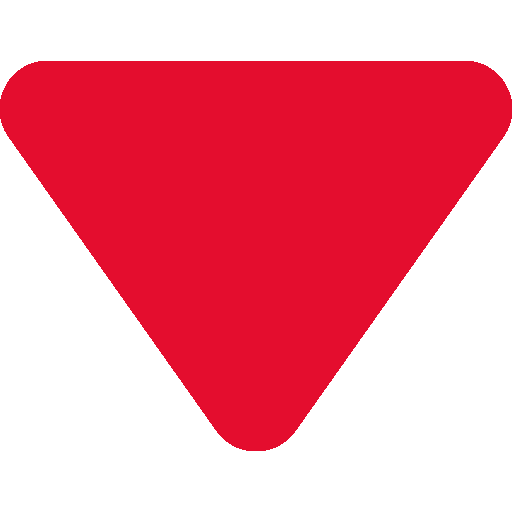
Titelthema: Endliche Ressourcen
Klimafreundlich, aber nicht unbegrenzt verfügbar
Doch auch der nachhaltigste Baustoff ist nur dann zukunftsfähig, wenn er verantwortungsvoll eingesetzt wird. Zwar wächst Holz nach, doch der Klimawandel setzt den Wäldern zu. Besonders betroffen ist die Fichte, die mit einem Anteil von 90 Prozent das wichtigste Bauholz ist. „Die Fichte liebt es kühl. Unser Klima wird aber wärmer und trockener“, so Schütt. Borkenkäfer, Stürme und Erosion machen dem Baum zu schaffen. Die Forstwirtschaft reagiere bereits mit Mischwaldstrategien und Alternativen wie Douglasie oder Kiefer. „Ich glaube, wir brauchen uns in Deutschland keine Sorgen um die Holzreserven zu machen. Voraussetzung ist aber, dass in der Forstwirtschaft weiter ein Umdenken stattfindet.“
Schütt habe sich bereits darauf eingestellt, dass die Fichte nicht unendlich zur Verfügung stehe. Das fordere auch neue Ansätze in der Verarbeitung, denn: Alternative Hölzer wie zum Beispiel Buche seien schwieriger zu bearbeiten. Mehr Verästelungen und schräger Wuchs fordern die Holzindustrie. Eine Schlüsselrolle spiele dabei das Verleimen: „Ich bin der festen Überzeugung, dass das Kleben ein ganz wichtiger Verarbeitungs- und Veredelungsprozess ist. Aus vielen kleineren, weniger guten Hölzern wird dadurch wieder ein schöner, großer Balken, wie man ihn von der Fichte kennt.“
Auch das Lebensende eines Holzgebäudes müsse künftig stärker mitgedacht werden. Aktuell werde abgerissenes Holz rechtlich als Abfall behandelt. Eine Wiederverwendung sei kompliziert. Schütt engagiert sich deshalb in der Studiengemeinschaft Holzleimbau für eine sogenannte Rücknahmevereinbarungen: „Alles, was wir verkaufen, wollen wir dadurch auch wieder zurücknehmen.“
Renaissance eines traditionellen Baustoffs
Wenn Tillmann Schütt über Holz spricht, dann mit der Überzeugung eines Geschäftsführers, der das Material nicht nur schätzt, sondern auch um seine Grenzen weiß. Sein Unternehmen – die Gebr. Schütt KG in Landscheide-Flethsee nahe Brunsbüttel – hat sich auf die Herstellung von Brettschichtholz spezialisiert. Aus großen, tragenden Bauteilen aus verleimtem Holz werden Reithallen, Bürogebäude und Kindertagesstätten. Die verwendeten Hölzer kommen überwiegend aus Österreich. Per Bahn gelangen diese zum firmeneigenen Gleisanschluss.
Holz ist einer der ältesten Baustoffe der Menschheit und trotzdem lange Zeit aus dem Blick moderner Bauprojekte geraten. Stahl und Beton dominierten, auch dank starker Industrien und ihrer Einflussnahme auf Normen und Vorschriften, erzählt Schütt. Erst seit zwei Jahrzehnten erlebe der Holzbau eine Renaissance: „Er war immer klassisch handwerklich mittelständisch geprägt – ohne echte Industrie und Lobby“, so der Geschäftsführer. Inzwischen würden auch mehrgeschossige Gebäude und Hochhäuser aus Holz entstehen, der Markt für Holz als Baumaterial für Wohnraum wachse jährlich um 10 bis 15 Prozent.




"In der Forstwirtschaft muss weiter ein Umdenken stattfinden"
TILLMANN SCHÜTT
Holz intelligent nutzen
Etwa 40 Prozent des abgebauten Holzes fließen derzeit in den Hoch- und Möbelbau. Weitere Anteile machen die Papier-, Zellstoff- oder Verpackungsindustrie aus. Rund zehn Prozent werden energetisch genutzt. „Wenn wir wissen, dass Holz eine wertvolle Ressource ist, die im Bauen einen echten Klimabeitrag leisten kann, dann müssen wir uns fragen: Wollen wir sie wirklich verheizen?“ Denn: Rund 38 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und Müllaufkommens entstehen durch den Bausektor. Holzbauten können dies ändern, denn sie haben eine deutlich bessere Klimabilanz als andere Materialien.
Sand ist nicht gleich Sand
Von einem Ende des Nord-Ostsee-Kanals geht es fast zum anderen Ende nach Warder im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Hinter Bäumen und Büschen versteckt liegt ein Ort, an dem täglich Rohstoffgeschichte geschrieben wird. Hier betreibt die Glindemann Gruppe eines von zwölf Kieswerken in Schleswig-Holstein. Seit mehr als 50 Jahren ist das Familienunternehmen im Geschäft – mit Sand, Kies und Verantwortung. Denn was auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, ist für den Bau von Häusern, Straßen und Infrastruktur essenziell. Und dabei alles andere als unerschöpflich.
Dass in einem Land mit Küsten und Sandstränden Kiesknappheit herrscht, klingt zunächst widersprüchlich. Doch es kommt auf die Körnung an. „Unser Kies hat Ecken und Kanten. Das braucht er, damit er sich im Beton verzahnt“, erklärt Geschäftsführer Lars Glindemann. Wüstensand dagegen sei zu rund, Meeressand zu salzhaltig. Ein Abbau in der Sahara oder am Ostseestrand wäre zudem umweltschädlich und teuer. „Wir müssen also mit dem arbeiten, was wir vor Ort haben – und das so effizient und nachhaltig wie möglich.“
Rund 20 Millionen Tonnen Sand und Kies werden jährlich in Schleswig-Holstein benötigt. Die Vorräte könnten theoretisch noch 175 Jahre reichen. Das Problem: Es fehlt an genehmigten Flächen. „Wir haben die Ressourcen, aber kommen nicht ran“, sagt Glindemann. Genehmigungsverfahren würden häufig fünf bis zehn Jahre dauern. Zudem konkurrieren die potenziellen Flächen mit Landwirtschaft, Naturschutz und Energieprojekten. Die Folge: Kiesimporte aus Schottland, Norwegen oder Dänemark müssen her. Auch Lars Glindemann kauft trotz seiner zwölf Werke aus dem Ausland dazu. „Das ist vom Umweltgedanken her kaum nachvollziehbar und frustrierend.“
Zwischen gesellschaftlicher Akzeptanz und Planungshürden
Viele Menschen wünschen sich ein Eigenheim, überall entstehen Neubaugebiete. Ein schönes, geräumiges Einfamilienhaus? Ja bitte! Doch eine Kiesgrube möchte keiner in der Nähe haben. Die Ablehnung in der deutschen Gesellschaft sei ein echtes Problem. In Skandinavien funktioniere dies deutlich besser. „Beteiligte werden früh eingebunden, und Konzepte entstehen an einem Gemeinschaftstisch“, so der Unternehmer weiter. „In Kopenhagen gibt es eine Skipiste auf einer Müllverbrennungsanlage, und auf einer Deponie entstand ein Naherholungsgebiet für Mensch und Natur. Das sind pragmatische Lösungen, von denen Natur und Gesellschaft profitieren.“ Glindemann kritisiert, dass die deutsche Mentalität leider häufig eine andere sei. Es dominerten Einzelinteressen und Misstrauen. Dass Kiesabbau nicht zwangsläufig Zerstörung bedeutet, zeigen Projekte wie in Warder. Dort entstanden in Kooperation mit dem Naturpark Westensee und Umweltstiftungen nach dem Abbau artenreiche Trockenrasenflächen. Auch der beliebte Park für alte Haus- und Nutztierrassen Arche Warder liegt auf einem ehemaligen Kieswerk. „Während des Kiesabbaus findet die Renaturierung bereits statt“, so Glindemann. Seen, Rückzugsmöglichkeiten für Tiere, neue Lebensräume: Die Natur holt sich den Raum nach der Nutzung durch den Menschen zurück. Auch das aktuelle Werk in Warder ist bald „ausgekiest“. Was bleibt, ist ein See und die Frage, wie es weitergeht. Neue Flächen brauchen Zeit und frühzeitige Genehmigungen. „Sand und Kies wachsen nun mal nicht nach. Und eine neue Eiszeit wird wohl keiner von uns erleben.“ Umso wichtiger sei es, heute die Voraussetzungen für morgen zu schaffen.

Klimakünstler
Der Bausektor könnte seine Klimabilanz durch den Fokus auf Holz deutlich aufbessern.
















Brauchwasserkreislauf dringend benötigt
Im Gegensatz zu Kies scheint Wasser auf den ersten Blick allgegenwärtig, gleichzeitig ist es global vielerorts ein knappes Gut. Zwar haben wir laut Professorin Nicola Fohrer, Hydrologin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, in Schleswig-Holstein ausreichend Niederschlag, doch eben nicht immer zur richtigen Zeit. „Durch den Klimawandel herrschen im Norden häufiger längere, trockene Sommer und Starkregenperioden. Die Landwirtschaft ist von den Entwicklungen besonders betroffen, doch auch Unternehmen anderer Branchen müssen umdenken“, sagt sie. Viele kleine und mittlere Betriebe unterschätzen die Rolle des Wassers in ihren Prozessen, so die Hydrologin weiter. Ein professionelles Regenwassermanagement suche man oft vergeblich – sei es aus Unwissenheit, Personalmangel oder wegen mangelnder Anreize. Dabei gebe es Lösungen, wie zum Beispiel Zisternen, die nicht nur ressourcenschonend sind, sondern auch finanzielle Anreize bieten. Regenwasser ist schließlich günstiger als Trinkwasser.
„Wir verschwenden wertvolles, teureres Trinkwasser für Toiletten, die Bewässerung von Grünanlagen oder die Reinigung von Maschinen. Daher brauchen wir dringend einen funktionierenden Brauchwasserkreislauf.“ Doch wie soll das Ganze umgesetzt werden? Eine eigene Regenwassermanagerin, wie es zum Teil große Konzerne haben, können sich mittelständische Betriebe in Schleswig-Holstein nicht leisten. Fohrer sieht hier einen dringenden Beratungsbedarf. „Zudem müssen staatliche Förderung und Anreizsysteme geschaffen werden, um unser wertvolles Wasser zu schützten.“
Die Beispiele zeigen: Wer mit endlichen Ressourcen arbeitet, trägt Verantwortung – für Umwelt, Mitarbeitende und künftige Generationen. Ob im Holzbau, im Kieswerk oder beim Umgang mit Wasser: Unternehmen in Schleswig-Holstein denken längst über das Tagesgeschäft hinaus. Sie investieren in Technik, Dialoge und neue Prozesse. Doch ohne politische Rückendeckung, verlässliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Akzeptanz bleibt der Spielraum begrenzt. Der sparsame, intelligente Umgang mit Ressourcen ist keine Frage der Zukunft, er beginnt jetzt. Und er braucht alle: Wirtschaft, Staat und Gesellschaft.