Warum sich echtes Selbstbewusstsein
manchmal wie Unsicherheit anfühlt
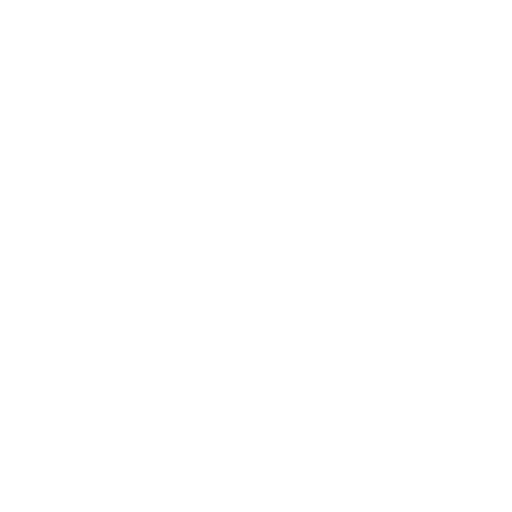
Aus dem Netz
Magdalena Rogl weiß, wovon sie spricht. Als Quereinsteigerin in der Digitalbranche, Mutter, Speakerin und Diversity-Managerin hat sie selbst erlebt, wie sich äußere Erwartungen und innere Zweifel überlagern können. Für Anker schreibt sie über ein Thema, das viele Unternehmerinnen und Unternehmer bewegt – und doch selten offen besprochen wird: Was bedeutet es, endlich genug zu sein? Und wie entsteht echtes Selbstbewusstsein jenseits von Status und Leistung? Ein ehrlicher, inspirierender Blick auf die Kraft der Selbstakzeptanz in einer Welt, die ständig nach mehr verlangt.
„Nicht gut genug“: Das ist ein Gedanke, der mich schon mein ganzes Leben begleitet – und ehrlich gesagt auch immer wieder einholt.
In der Schule hatte ich nie gute Noten, bin sogar durchgefallen. Mein Zeugnis sagte klar: Du bist nicht gut genug. Das ist zwar 25 Jahre her – aber das Gefühl kenne ich noch heute.
Ich habe kein Abitur, kein Studium. Ich bin gelernte Kinderpflegerin und habe fünf Jahre in diesem Beruf gearbeitet. In diesen fünf Jahren hatte ich das Gefühl, gut zu sein. Genug zu sein. Richtig zu sein.
Aber mit 25, alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern, wusste ich: Ich muss mich verändern. Ich wagte den Quereinstieg in die digitale Arbeitswelt. Und plötzlich fühlte ich mich nicht mehr genug. Nicht technisch genug. Nicht strategisch genug. Nicht „Business“ genug.
Was ich damals nicht wusste: Selbstzweifel sind kein Zeichen von Schwäche – sondern von echtem SelbstBEWUSSTsein. Nur wer sich selbst hinterfragt, übernimmt auch Verantwortung. Und manchmal liegt die größte Stärke darin zu sagen: „Ich weiß es gerade nicht.“
Lange dachte ich, mein Gefühl sei mein persönliches Problem. Bis ich verstand: Das Impostor-Syndrom – also das Gefühl, eine Hochstaplerin zu sein – ist kein persönliches Versagen. Es ist ein Systemfehler. Und diesen Fehler können wir beheben. Gemeinsam.
Unsere Arbeitswelt braucht keine perfekten Lebensläufe, sondern Menschen, die Verantwortung übernehmen. Keine Hochglanzfassaden, sondern echtes Gefühl. Schluss mit „Fake it till you make it“. Wir brauchen weniger Schein, mehr Sein.
Ich erinnere mich an einen Moment, der mir das besonders deutlich gemacht hat. Ich war auf dem Weg zu einem Vortrag, durchgetaktet wie immer. Eine Nachricht kam: „Hast du kurz Zeit?“ Ich spürte, da ist mehr dahinter. Wir telefonierten. Nach ein paar Sätzen zitterte seine Stimme. „Ich weiß gerade nicht mehr, wie ich das alles schaffen soll.“ Kein Drama. Aber echt.
Ich stand mitten im Bahnhof, Handy in der einen, Koffer in der anderen Hand – und hörte zu. Weil ich wusste: Dafür müssen wir Raum schaffen. Für Momente, in denen jemand nicht funktionieren, sondern einfach nur gehört werden will.
Verantwortung heißt nicht, immer eine Lösung zu haben. Verantwortung heißt manchmal einfach, da zu sein. Was wäre, wenn wir Verantwortung nicht als Titel sehen, sondern als Haltung? Wenn wir Führung nicht daran messen, wie laut jemand spricht – sondern wie gut jemand zuhört?
Empathie ist kein Soft Skill. Sie ist eine Superkraft. Und sie ist lernbar.
Dafür braucht es eine neue Haltung in unserer Arbeitswelt: eine, in der nicht ständig optimiert, sondern auch mal innegehalten wird. In der Fehler geteilt werden dürfen. Und in der jede und jeder sagen darf: Ich bin genug. Denn: Gut ist gut genug. Und je mehr künstliche Intelligenz es gibt, desto mehr emotionale Intelligenz brauchen wir.
Ich wünsche mir eine Arbeitswelt, in der Menschen zählen. In der Verantwortung nicht delegiert, sondern geteilt wird. Und in der wir aufhören, uns selbst infrage zu stellen – und anfangen, das System zu hinterfragen. Wir tragen Verantwortung. Für uns. Für einander. Für das System.
Und wir haben die Chance, es zu verändern – mutig, menschlich, gemeinsam.